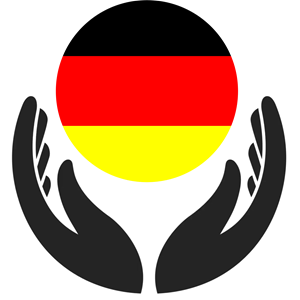ADS / ADHS / Ritalin
Generation Ritalin
Die Ursachen von Lern- und Verhaltensproblemen und die Wirkung von Psychostimulanzien bei Schülern mit ADS-Symptomatik
Ein Artikel von Pro. Dr. Gerald Hüther
In Deutschland werden gegenwärtig etwa 150 000 an ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom) leidende Kinder und Jugendliche mit niedrigdosierten Psychostimulanzien behandelt. Weltweit sind es sogar einige Millionen Kinder.
Die Effizienz dieser Behandlung wird bereits seit den 50er Jahren auf die dopaminfreisetzende Wirkung dieser Substanzen zurückgeführt. Eine unzureichende Aktivität des dopaminergen Systems im Gehirn dieser Kinder wird deshalb für die Entstehung und Aufrechterhaltung der ADS-Symptomatik verantwortlich gemacht. Wie tragfähig sind diese alten Modellvorstellungen heute noch?

Die Medizin ist eine anwendungsorientierte Disziplin. Wie in allen anderen anwendungsorientierten Disziplinen entwickeln daher auch die Mediziner ihre handlungsleitenden Modellvorstellungen aus dem, was in der Praxis funktioniert. Was sie unter einer Krankheit verstehen, wie sie entsteht und wie sie zu therapieren ist, wird also immer in erster Linie aus den Erfolgen und Misserfolgen abgeleitet, die Ärzte bei ihren Behandlungsversuchen erzielen. Im Fall von hyperkinetischen und aufmerksamkeitsgestörten Kindern führten diese Bemühungen immer dann zu einem besonders raschen und spürbaren Erfolg, wenn den Kindern ein Mittel aus einer Substanzgruppe verabreicht wurde, die als Psychostimulanzien bezeichnet wird, also Methylphenidat (Ritalin®), D-Amphetamin (Aderall®) und natürlich auch, wenngleich selten öffentlich gemacht, Kokain. Psychostimulanzien, das wussten die Mediziner schon lange, und das steht auch in jedem pharmakologischen Lehrbuch, erhöhen die Dopaminfreisetzung im Gehirn. Wenn sich durch eine solche pharmakologische Erhöhung der Dopamin-freisetzung eine derartig dramatische Verbesserung der Symptomatik von hyper-aktiven und/oder aufmerksamkeitsgestörten Kindern erreichen läßt, so mußte im Gehirn der betreffenden Patienten eine unzureichende Dopaminsynthese oder –freisetzung für die Entstehung und Aufrechterhaltung des gestörten Verhaltens verantwortlich sein. Diese Schlussfolgerungen war jedermann so einleuchtend und logisch, dass heute nur noch schwer nachvollziehbar ist, wer diese „Dopaminmangel-hypothese“ als Ursache von Hyperaktivität und Aufmerksamkeits-störung zuerst formuliert hat.
Als diese Modellvorstellung entstand, galten beide Verhaltensauffälligkeiten noch als Hauptsymptome eines Krankheitsbildes, das bis dahin als Minimal Cerebral Dysfunction (MCD) bezeichnet worden war. Nicht nur der Nachweis, dass bei vielen Kindern mit MCD keine Anzeichen einer Hirnschädigung vorlagen, sondern auch der erfolgreiche Einsatz und die Ausbreitung der Psychostimulanzien Behandlung bei Kindern mit diesem Störungsbild, und nicht zuletzt das aus der Wirkung dieser Medikamente abgeleitete „neurobiologische (hirnorganische) Modell“ zur Erklärung dieses Störungsbildes bildeten die entscheidenden Voraussetzungen für den Entschluss der American Psychiatric Association, die Bezeichnung „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ (ADHS, neuerdings ADS) für diese Störung einzuführen und sie in den Katalog psychischer Erkrankungen (ICD-10, DSM-IV) aufzunehmen.
Innerhalb weniger Jahre kam es nachfolgend zu einem dramatischen Anstieg der mit dieser Erkrankung diagnostizierten und mit Psychostimulanzien behandelten Kinder und Jugendlichen, zunächst in den USA und dann auch in Europa. Inzwischen werden nach Schätzungen des International Narcotics Control Board, der Drogenüberwachungsbehörde der UNO, weltweit ca. 10 Mio. Kinder und Jugendliche mit Psychostimulanzien behandelt. ADS ist inzwischen das von allen kinder- und jugendpsychiatrischen Störungen mit Abstand am intensivsten erforschte Krankheitsbild. Trotz dieser intensiven Forschungsanstrengungen ist es bis heute jedoch nicht gelungen, das ursprünglich allein aus der Medikamentenwirkung abgeleitete Dopamindefizit im Gehirn der betreffenden Patienten auch wirklich nachzuweisen. Der Versuch, die Ursachen von psychischen Krankheiten genetisch zu begründen, folgt einem Weltbild des vergangenen Jahrhunderts. Viele Forscher sind aufgebrochen, um etwa für Schizophrenie, Depression oder auch ADHS nach entsprechenden Erbanlagen zu suchen. Doch was sie bisher zutage gefördert haben, ist nicht sehr überzeugend. Das Muster wiederholt sich immer wieder: Zunächst glaubt man, entsprechend veränderte Gene gefunden zu haben, einige Zeit später erweist sich dann, dass es diese auch bei Gesunden gibt. Heute ist unbestritten, dass man eine Kombination von sehr vielen Genen braucht, um eine hohe Prädisposition dafür zu bekommen, dass sich die Krankheit tatsächlich entwickelt. Und auch das reicht noch nicht, denn es gibt auch bei allen genetisch bedingten Störungen eine Vielzahl von Faktoren, die verhindern können, dass trotz einer solchen Veranlagung die Störung wirklich auftritt.
Neue Erkenntnisse zur Wirkung von Psychostimulanzien
In hohen Konzentrationen, rasch ins Hirn geflutet, bewirken die zur medikamentösen Behandlung von ADS eingesetzten Psychostimulanzien eine massive Dopamin-freisetzung. Es gibt Berichte, dass das auch mit Ritalin geht. Dazu werden die Pillen zerrieben und geschnupft. Es entsteht dann ein kokainartiger Rausch. Wenn auf diese Weise, also geschnupft oder gespritzt die Dopaminfreisetzung in Gehirn stimuliert wird, kommt es zu einer massiven Verstärkung innerer Impulse in Handlung. In der Drogenszene werden diese Substanzen deshalb in dieser Weise benutzt, etwa um Sex zu verbessern oder rauschartige Zustände zu erreichen. In niedriger Dosierung und bei oraler Einnahme erfolgt keine Dopaminfreisetzung, sondern nur eine Hemmung der Dopaminwiederaufnahme. Extrazelluläres Dopamin aktiviert dann die Autorezeptoren an den dopaminergen Präsynapsen und daraufhin kommt es zu keiner weiteren Dopaminausschüttung.
Man nennt das Hemmung der impulsgetriggerten Dopaminfreisetzung. Die Folge ist, dass innere Impulse nicht mehr durch Dopamin verstärkt und so in Handlungen umgesetzt werden. Deshalb „funktionieren“ die Kinder dann besser. Gesunde nehmen Psychostimulanzien als cognitive enhancer (Hirndoping) ein, und nutzen damit die Unterdrückung innerer Impulse zur Steigerung ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit. Obwohl Sie Hunger haben, müde sind, sich bewegen oder ein anderes Bedürfnis stillen wollen können sie einfach weiterarbeiten. Bei den sog. ADS-Kindern wird durch die Hemmung der impulsgetriggerten Dopaminfreisetzung eben all das abgestellt, was sie als besonders dringende innere Impulse bis dahin immer in entsprechende Handlungen umgesetzt haben: bei Jungs häufiger Bewegungsimpulse (Zappelphillip), bei Mädchen häufiger Rückzugsimpulse (Traumsusen). Wenn man diesen Kindern nicht dabei hilft, ihre Impulse selbst steuern zu lernen, werden sie sich nur schwer im Leben zurechtfinden. Sie werden Schulversager, bekommen keine Ordnung in ihr Leben, lassen sich auf alle möglichen Extremerfahrungen, auch auf Drogenkonsum ein. Manche landen so sogar in einer Drogenkarriere.
Wenn man diese Gruppe dann später mit solchen Personen vergleicht, die medikamentös behandelt worden sind und meist ja auch noch als Erwachsene diese Pillen einnehmen, kann gar kein anderes Ergebnis herauskommen als ein Positives: bessere Schulleistungen, weniger Junkies. Aber das ist eigentlich Augenwischerei, denn verglichen werden müssten die Effekte der medikamentösen Behandlung mit den Effekten einer erfolgreich verlaufenen therapeutischen oder pädagogischen Intervention.
Und zwar einer, die wirklich dazu geführt hat, dass die betreffenden Kinder und Jugendlichen die Erfahrung machen und in ihrem Gehirn verankern konnten, dass sie in der Lage sind ihre Impulse selbst zu steuern. Genau das müsste das Ziel unser Bemühungen um diese besonderen Kinder sein. Aber statt gezielt nach neuen und in dieser Weise wirksamen Behandlungsstrategien zu suchen, verlaufen wir uns in kontroversen Diskussionen.
Erkenntnisse zur Plastizität des sich entwickelnden Gehirns
Das kindliche Gehirn hat sich als weitaus plastischer erwiesen, als das noch vor zwei Jahrzehnten für möglich gehalten wurde. Die genetischen Programme sorgen dafür, dass zunächst weitaus mehr Vernetzungsoptionen zwischen den Nervenzellen aufgebaut werden, als später wirklich gebraucht und stabilisiert werden. Es gibt also anfangs viel zu viele Vernetzungen, und davon werden nur diejenigen stabilisiert, die ein Kind in seinem Lebensraum aus seiner subjektiven Bewertung heraus intensiv benutzt. Gene können keine Beziehungen zwischen Nervenzellen regulieren, Gene können nur einzelne Nervenzellen dazu bringen, dass sie auf einen bestimmten Impuls mit einer bestimmten Antwort reagieren. Das ist ja auch die erschütternde Erkenntnis des Human-Genom-Projekts: Nicht das Genom ist entscheidend, viel spannender sind die Signale, die die Gene regulieren. Mit der epigenetischen Sicht hat die alte Genetik inzwischen ja längst ihre ursprüngliche Sichtweise in Frage gestellt. Genetisch bedingt und angeboren ist, dass etwa ein Drittel mehr Vernetzung im Kortex bereitgestellt als später auch benutzt und stabilisiert wird. Es handelt sich also um ein genetisch bereitgestelltes Potenzial. Im Bild gesprochen: Es wird ein Orchester zusammengestellt, das alles Mögliche spielen konnte. Aber was für Stücke es tatsächlich aufführt, wer zuhört und für wen und unter wessen Leitung gespielt wird, muss sich jeweils erst entscheiden. Ob ein Kind in der Lage ist, seine Impulse zu steuern, Handlungen zu planen und die Folgen seiner Handlungen abzuschätzen, hängt von der Effizienz, der in seinem präfrontalen Cortex herausgeformten Netzwerke zur Steuerung der sog. Exekutiven Frontalhirnfunktionen ab.
Die Entwicklung des präfrontalen Kortex ist ein äußerst komplizierter und daher höchst störanfälliger Prozess, dessen Verlauf und Ergebnis beim Menschen im Wesentlichen durch die während der Kindheit gemachten eigenen Erfahrungen bestimmt wird. Genetisch gesteuert ist hierbei lediglich der während der pränatalen und postnatalen Entwicklung ablaufende Prozess der Herausbildung eines Überangebotes an axonalen und dendritischen Fortsätzen und Verbindungen sowie eines Überschusses entsprechender „synaptischer Angebote“. Beim Menschen wird das Maximum synaptischer Angebote und die höchste Synapsendichte im präfrontalen Kortex etwa im 6. Lebensjahr erreicht. Bis zu diesem Alter sollten Kindern vielfältige Gelegenheiten geboten werden, möglichst viele dieser vorläufigen Angebote nutzungsabhängig zu stabilisieren, d.h. unter Anleitung durch geeignete Vorbilder, diejenigen synaptischen Aktivierungsmuster wiederholt aufzubauen und dadurch auch strukturell zu festigen, die später als innere Repräsentanzen zur Organisation und Planung von Verhaltensreaktionen benutzt werden. Gelingt es einem Kind während dieser Entwicklungsphase nicht, diese hochkomplexen Aktivierungsmuster in seinem Frontalhirn herauszubilden, so fehlt ihm später die Möglichkeit, seine Verhaltensreaktionen „autonom“ unter Zuhilfenahme innerer handlungsleitender Muster zu steuern. All jene im kindlichen Hirn angelegten neuronalen Verschaltungen und synaptischen Verbindungen, die während dieser Entwicklungsphase nicht in funktionelle innere „Repräsentanzen“ integriert und auf diese Weise nutzungsabhängig stabilisiert werden können, gehen zugrunde und werden wieder abgebaut („pruning“).
Ein neuer Blick auf die Herausbildung einer ADS-Symptomatik
Wenn wir uns vom mechanistischen Bild des Gehirns als einer Maschine verabschieden, öffnet sich der Blick dafür, dass das menschliche Gehirn als ein sich selbst organisierendes System zu verstehen ist, das sich in hohem Maße durch Erfahrungen in Interaktionen strukturiert. Einfach ausgedrückt:
Beziehungserfahrungen werden in neuronale Beziehungsmuster transformiert. Es ist recht bedauerlich, dass dieses neue Denken in den «orthodoxen Kreisen» der Kinder und Jugendpsychiatrie, noch nicht angekommen ist, und man dort ständig die alte Behauptung wiederkäut, im Gehirn von ADHS-Patienten gäbe es zu wenig Dopamin. Bisher hat niemand wirklich gemessen, dass in deren Gehirn zu wenig Dopamin freigesetzt wird. Das geht auch gar nicht, denn dazu müsste man Verfahren wie die Mikrodialyse einsetzen, bei denen wie bei Versuchstieren, ein semipermeabler Schlauch in das Gehirn eingeführt wird.
Ein Faktor, der für die Herausbildung einer ADS-Symptomatik von entscheidender Bedeutung für diese Kinder ist, ist eine nur unzureichend gemachte Erfahrung von «shared attention». Diese Fähigkeit zu „geteilter Aufmerksamkeit“ entsteht nicht von allein. Dazu muss ein Kind die Erfahrung machen, wie schön es ist, sich mit jemand anderem auf etwas zu freuen, etwas gemeinsam zu gestalten. Das geschieht beim gemeinsamen Anschauen eines Kinderbuches etwa, oder wenn die Mama das Kind auf dem Arm hält und beide beobachten, wie die Katze im Hof spielt. Das ist etwas anderes, als wenn die Mutter das Kind auf den Arm nimmt und küsst. Shared attention heißt, sich gemeinsam in etwas Drittem zu finden, dort gleichzeitig frei und verbunden zu sein.
Die Erfahrung dieser „shared attention“ bildet die Voraussetzung dafür, dass wir individualisierte Gemeinschaften ausbilden können. Durch shared attention lernen wir, unsere eigenen Impulse zu kontrollieren, uns auf etwas Gemeinsames einzulassen. Diese Erfahrung wird dann im Frontalhirn verankert. Machen Kinder diese Erfahrung nicht, bleiben sie in der personalen Beziehung hängen. Dann entstehen Situationen, wie sie etwa ein Junge, nennen wir ihn Fritzchen, im Kindergarten erlebt: Alle Kinder kommen zusammen, um gemeinsam einen Turm zu bauen. Fritzchen will auch dazu gehören, er kann es aber nur, indem er eine personale Beziehung herstellt, was dann dazu führt, dass er an den anderen herummacht und sie stört. So geht er den anderen auf die Nerven und wird aus der Gruppe ausgeschlossen. Für so eine schmerzvolle Erfahrung gibt es nur zwei Bewältigungsstrategien. Und die werden dann im Gehirn des betroffenen Kindes gebahnt, je häufiger die eine oder die andere „erfolgreich“ eingesetzt wird: Aktiv kaputtmachen, womit sich die anderen gemeinsam beschäftigen (ADHS) oder passiver Rückzug in eigene Denkmuster (ADS). Dieses Konzept hat bisher in der ADHS-Forschung keine Beachtung gefunden. Deshalb fehlen uns hier auch gezielte Untersuchungen. Aber das Konzept ermöglicht Vorhersagen über günstige, protektive Konstellationen, die mit empirischen Befunden übereinstimmen:
Weniger häufig findet man ADHS-Symptomatiken bei Kindern, die in Familien auf-wachsen, in denen ein Vater als „Dritter“ vorhanden ist, wo sich die ganze Familie um jemanden (den Familienhund, die kranke Großmutter) oder etwas (ein Familien-projekt) kümmert, die in eine Gemeinschaft (Dorf, Verein) eingebunden sind, die Schulen besuchen, in denen stärker auf Kooperation und gemeinsame Ziele als auf Wettbewerb um die besten Zensuren gesetzt wird.
Ein neuer Blick auf die Folgen der medikamentösen Behandlung
Inzwischen ist mit Hilfe funktioneller bildgebender Verfahren am Beispiel verschie-denster psychiatrischer Störungen nachgewiesen worden, dass psychotherapeutische Interventionen ebenso wie medikamentöse Behandlungen sogar noch im adulten Gehirn zu nutzungsabhängigen Umstrukturierungen neuronaler Netzwerke und synaptischer Verschaltungen führen können. Aus entwicklungsneurobiologischer Perspektive ist davon auszugehen, dass derartige strukturelle Reorganisations-prozesse um so leichter auslösbar sind, und um so besser gelingen, je früher sie initiiert werden, d.h. je jünger der Patient ist und je plastischer die in seinem Gehirn angelegten neuronalen und synaptischen Verschaltungsmuster noch sind. Die nachhaltigsten Veränderungen bisheriger Nutzungsmuster lassen sich bei Kindern durch Veränderungen des jeweiligen sozialen Beziehungsgefüges erreichen, das das bisherigen Denken, Fühlen und Verhalten der betreffenden Kinder ermöglicht, bestimmt und gefestigt hat. Welche psychotherapeutische, psychosoziale oder pädagogische Intervention sich hierfür am Besten eignet und die nachhaltigsten Veränderungen auszulösen imstande ist, muss für jedes Kind unter Berücksichtigung seiner bisherigen Entwicklung und seines sozialen und familiären Umfeldes individuell entschieden werden. Wenn es einem Kind gelungen ist, durch neue Erfahrungen Fähigkeiten zu entwickeln, die es vorher nicht hatte, dann werden diese neuen Erfahrungen im Gehirn verankert. Damit ist eine entscheidende Voraussetzung dafür geschaffen, dass es auch in seiner jeweiligen Lebenswelt nun besser zurechtkommt.
Es geht also nicht darum, dass wir einen Lebensraum schaffen, in dem das Kind geborgen und geschützt ist, sondern dass wir ihm z. B. in der Schule eine neue Erfahrung ermöglichen – eine, die dann Spuren hinterlässt in Form von neuronalen Beziehungsmustern, von gefestigten exekutiven Frontalhirnfunktionen, und die nimmt das Kind ja mit jeder neuen Selbstwirksamkeitserfahrung mit in seine familiäre Lebenswelt. Wenn all diese Versuche scheitern und auf diesem Wege keine Besserung erreichbar ist, so mag eine medikamentöse Behandlung im Einzelfall als vorübergehende Übergangslösung in Betracht gezogen werden. Die neurobiologischen Auswirkungen einer langfristigen oralen Einnahme von Psychostimulanzien während der Kindheit sind bisher kaum untersucht und daher gegenwärtig schwer abschätzbar. Klinisch lässt sich selbst nach jahrelanger Methylphenidat-Einnahme keine stabile Besserung der Symptomatik nach Absetzen der Medikation verzeichnen. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass es während des Behandlungszeitraumes offenbar nicht zu einer Normalisierung des überstark entwickelten, antriebssteigernden dopaminergen Systems oder einer effizienten Nachreifung exekutiver Frontalhirnleistungen kommt. Im Gehirn der betreffenden Kinder und Jugendlichen kommt. Fraglich ist zudem, ob die Verankerung von Erfahrungen eigener Effizienz bei der Bewältigung von Herausforderungen, bei der Impulskontrolle und der Fokussierung der Aufmerksamkeit überhaupt in Form innerer Repräsentanzen erfolgen kann, so lange das Kind diese Leistungen nicht sich selbst, sondern der Wirkung des eingenommenen Medikamentes zuschreibt.
Fazit
Die enormen Forschungsanstrengungen, die bisher zur Aufklärung der mit dieser Störung assoziierten neurobiologischen und molekulargenetischen Auffälligkeiten und der insbesondere durch medikamentöse Behandlungen auslösbaren therapeutischen
Effekte bei ADS-Patienten gemacht wurden, stehen in eklatanten Mißverhältnis zu den bisherigen Bemühungen, geeignete präventive Maßnahmen zur Verhinderung der Manifestation dieses Störungsbildes zu erarbeiten, einzusetzen und im Rahmen präventiver Interventionsprogramme wissenschaftlich im Hinblick auf ihre Effizienz zu
überprüfen. Ursache hierfür ist einerseits das klassische alte Reparaturdenken, das bisher die Praxis, die Forschung und die Theoriebildung in der Medizin bestimmt hat und noch immer weitgehend bestimmt. Andererseits wurde die Vorstellung eines „Dopamindefizits“ im Hirn hyperkinetischer und aufmerksamkeitsgestörter Kinder automatisch mit der Annahme verbunden, dass diese Veränderung des dopaminergen System nur genetisch bedingt sein könne. Solange aber eine genetisch verursachte
„Stoffwechselstörung“ für die Ausbildung dieses Störungsbildes auf der Verhaltensebene verantwortlich gemacht wurde, musste jeder Versuch, die Manifestation dieser Verhaltensstörungen durch präventive Maßnahmen zu verhindern, als nutzloses Unterfangen erscheinen. Das einmal entwickelte Bild über die Ursache der Störung war also zu einer denk- und handlungsleitenden inneren Orientierung geworden, die nun selbst alle weiteren Forschungsstrategien und therapeutischen Bemühungen bestimmte.
Wenn also in Zukunft verstärkt nach geeigneten präventiven Maßnahmen gesucht werden soll, die zur Verhinderung der Manifestation von ADS-Symptomen führen, so wird das nur gelingen, wenn wir uns von dem bisherigem Bild über die organisch, genetisch oder neurobiologisch begründeten Ursachen dieser Verhaltensstörungen verabschieden. Erst wenn ein neues, entwicklungsneurobiologisch orientiertes Konzept die alten Modelle abgelöst hat, kann auch gezielt nach Möglichkeiten gesucht
werden, die in diesen Kindern liegenden Potenziale, ihre Begabungen und besonderen Fähigkeiten zur Entfaltung zu bringen. Erst dann kann die Umsetzung erfolgreicher Präventivmaßnahmen in den Mittelpunkt der Anstrengungen um das Wohl und Wehe von auffälligen Kindern gerückt werden, bevor diese eine ADS-Symptomatik ausbilden. Es gibt natürlich die einflussreichen Verbände und AD(H)S-Selbsthilfegruppen, die noch sehr konventionell denken. Viele Eltern und auch manche
LehrerInnen fühlen sich von deren Argumentation angezogen. Das kann man auch verstehen. Viele dieser Eltern haben Angst vor dem Vorwurf, dass ihre Erziehung für diese Kinder vielleicht nicht optimal war. Deshalb empfinden sie die Vorstellung entlastend, dass das Hirn ihres Kindes irgendwie „kaputt“ sei oder ein genetischer Defekt vorliege, und dass das mit Ritalin bzw. Psychostimulanzien zu beheben sei. Die Elternverbände greifen dieses Bedürfnis auf und kämpfen mit unglaublicher Macht darum, dass das derzeitige Konzept bestehen bleibt. Viele von ihnen haben Probleme damit, dass ausgerechnet Hirnforscher ihnen vorhalten, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn man ein sich entwickelndes Gehirn in seiner Funktionsweise mit Hilfe von Medikamenten verstellt und das Kind dadurch kaum eine Chance auf Selbstorganisationsprozesse hat. Denn all das, was das Medikament mit seinem Gehirn macht, kann es ja dann selbst nicht durch eine eigene Anstrengung erlernen.
Autor
Prof. Dr. Gerald Hüther ist Leiter der Zentralstelle für Neurobiologische Präventionsforschung der Univ. Göttingen und Mannheim/Heidelberg. Er befasst sich mit dem Einfluss früher Erfahrungen auf die Hirnentwicklung, mit den Auswirkungen von Angst und Stress und der Bedeutung emotionaler Reaktionen. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und populärwissenschaftlicher Darstellungen.
RitalinSubstanz
Ritalin ist der Markenname eines verschreibungspflichtigen Medikaments, das von dem Pharmaunternehmen Novartis Pharma vertrieben wird. Der Hauptinhaltsstoff ist der amphetaminartige Wirkstoff Methylphenidat. Der Wirkstoff ist dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) (Anlage III) unterstellt.
Missbräuchlicher KonsumBeim missbräuchlichen, d. h. nicht bestimmungsgemäßen Konsum wird Ritalin wegen seiner anregenden Wirkung konsumiert: zur Vertreibung von Müdigkeit, zur Aufmerksamkeitssteigerung, um nächtelang studieren oder feiern zu können und um die euphorisierende Wirkung zu erleben. Über die Verbreitung des missbräuchlichen Konsums gibt es keine zuverlässigen Zahlen. Jedoch ist anzunehmen, dass ein gewisser Anteil der medizinischen Verschreibungen nicht bestimmungsgemäß konsumiert wird.
In der Drogenszene wird Ritalin auch als „Ersatz-Speed“ gehandelt. Die Tabletten werden zumeist oral eingenommen, jedoch auch pulverisiert nasal konsumiert (durch die Nase gesnieft), oder in Wasser aufgelöst injiziert. Eine besondere Gefahr geht vom Spritzen aus, denn die nicht löslichen Füllstoffe der Tablette können hierbei kleine Blutgefäße verstopfen und Schäden an der Lunge oder der Netzhaut hervorrufen.
RisikenBei bestimmungsgemäßem Gebrauch, d. h. nach ärztlicher Verordnung und in der verordneten Dosierung, treten als Nebenwirkungen des Medikaments sehr häufig Schlafstörungen und verstärkte Reizbarkeit auf. Häufig kommt es auch zu Appetitlosigkeit, Magenbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen. Zudem soll bei bestimmten Vorerkrankungen wie z. B. Erkrankungen im Herz-Kreislauf-System, Angsterkrankungen oder dem Tourette-Syndrom nach Angaben des Herstellers kein Ritalin eingenommen werden.
Bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch können jedoch deutlich höhere Dosierungen der Fall sein, mit weitreichenden Risiken. So ist unter anderem mit Krampfanfällen, Herzrhythmusstörungen sowie Kopfschmerzen und Verwirrtheit zu rechnen. Auch sind beispielsweise Angstzustände, Wahnvorstellungen oder Aggressivität möglich. In der aktuellen Forschung werden auch Halluzinationen und plötzliche Todesfälle als mögliche Risiken genannt. Bei nicht bestimmungsgemäßem Konsum kann sich auch eine psychische Abhängigkeit entwickeln.
Hintergrund zum medizinischen AnwendungsgebietDas medizinische Anwendungsgebiet von Ritalin umfasst zum einen das so genannte Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS), das vor allem bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen vorkommt. Es wird im Volksmund auch „Zappelphillip-Syndrom“ genannt. Zum anderen wird es bei der Narkolepsie eingesetzt. Bei dieser Erkrankung treten plötzliche Schlafanfälle während des Tages auf.
In der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt wurde Ritalin vor allem im Zusammenhang mit ADHS. Zwar wird der Wirkstoff seit über 50 Jahren eingesetzt, doch erst in den letzten Jahren geriet es in Deutschland in die Kritik, da es zu einem extremen Anstieg der Verordnungen kam. Diese haben von 1993 bis 2001 um das 20-fache zugenommen.
Die Kritik an der Verschreibungspraxis wuchs, da anzunehmen war, dass es vermehrt zu Fehldiagnosen bzw. Fehlverordnungen kommt, die eine missbräuchlichen Verwendung des Stimulantiums nach sich ziehen könne. Die Bundesärztekammer wurde daher im Jahre 2002 von der damaligen Bundesregierung gebeten, Empfehlungen für die Diagnose und Behandlung von ADHS zu entwickeln.
Wirkung beim Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS)Die medizinische Forschung hat die Ursachen noch nicht vollständig geklärt. Es gilt aber als sicher, dass das Störungsbild von ADHS nicht auf eine einzige Ursache zurückgeführt werden kann. Genetische und familiäre Bedingungen spielen sehr wahrscheinlich eine große Rolle. Die Forschung hat allerdings den Mechanismus im Gehirn aufgedeckt, der zu den Aufmerksamkeitsproblemen und der Unruhe führt. Bei ADHS-Erkrankten liegt ein Mangel an Dopamin im Gehirn vor, einem wichtigen Botenstoff, der für die Informationsübertragung zwischen bestimmten Nervenzellen zuständig ist. Ritalin stimuliert die dopaminhaltigen Nervenverbindungen, so dass die Informationsübertragung zwischen den Nervenzellen wieder hergestellt wird. Dadurch können sich die Betroffenen besser konzentrieren und werden ruhiger.
Es wird davon ausgegangen, dass sich bei bestimmungsgemäßen Einsatz und therapeutisch wirksamer Dosierung von Ritalin keine Abhängigkeit entwickelt. Hingegen würden Kinder mit unbehandeltem ADHS ein höheres Risiko für späteren Substanzmissbrauch haben. Dieser missbräuchliche Konsum zielt vermutlich ebenso darauf ab, die Unruhe zu dämpfen, wobei dann unter Umständen auch andere Substanzen wie Cannabis eine Rolle spielen können.
WARNUNG!!!
Fachärzte warnen vor einem Medikamentenmissbrauch in Verbindung mit Alkohol oder einem Konsum von Menschen, die nicht betroffen sind. Dies kann beim ersten Konsum zum Tod führen.
Ebenso wird vor der Verschreibung des Medikamentes auf eine Sorgfältige Diagnose hingewiesen, da oft Symptome von ADS oder ADHS auch mit hochintelligenten Kindern und Jugendlichen übereinstimmen können.